Schreiben für Geld: Was ist zu privat für dieses Internet?
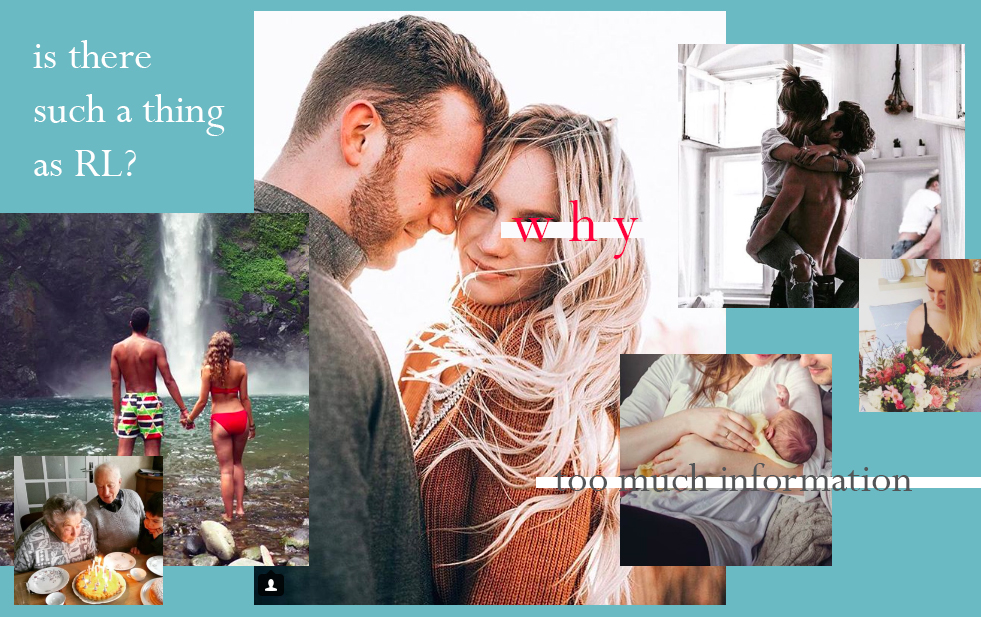
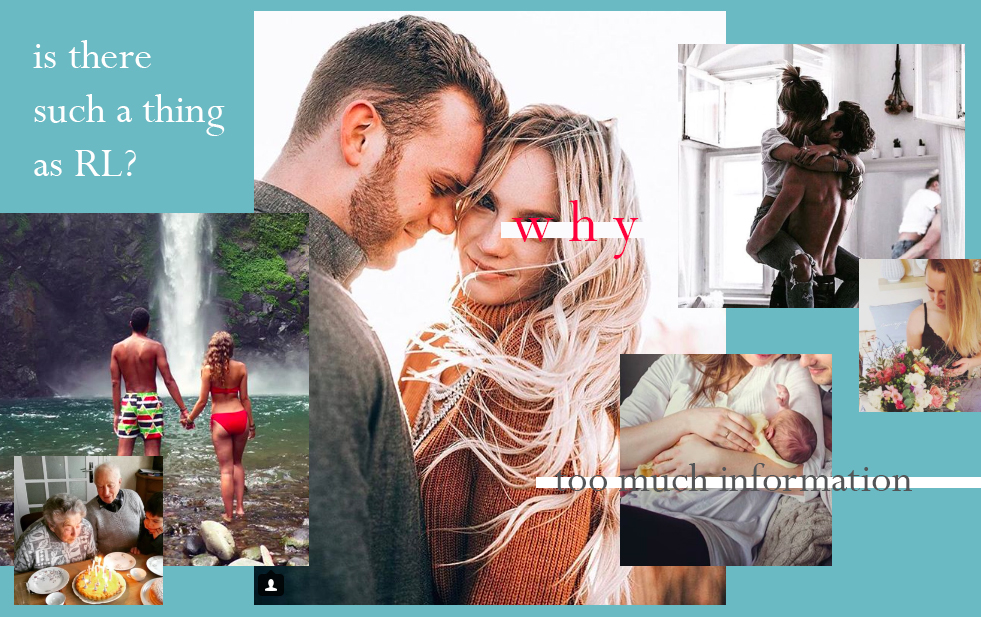
Diesen Beitrag gibt es hier auch als Audio.
______
Impulsantwort: erstmal nichts, wenn man sich so umsieht. Es gibt Autorinnen und Autoren, die schreiben detailliert und ungeschönt über ihre Datingerfahrungen, über Sehnsüchte, Depressionen (#notjustsad), Abtreibungen (großartig: plötzlich war da diese Falte im Nacken), Essstörungen. Traumata. Erlebnisse und Gefühle, die von vielen erfahren werden – aber trotzdem gesellschaftlich stigmatisiert sind. Es ist deshalb umso bewundernswerter, dass es Menschen gibt, die sich mit genau diesen Themen in die Öffentlichkeit trauen.
Was „zu privat“ ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern vielmehr ein sehr persönliches Gefühl von: was kann und möchte ich geben? Auch ein Grund, warum dieser Beitrag heute besonders subjektiv ausfällt.
Mein Hang zur (Über)reflektion hat mich schon ein paar Mal (nicht immer though) daran gehindert, einen Artikel zu schreiben, den ich vielleicht nachher – frei nach dem Motto „nur für den Klick für den Augenblick“ – bereut hätte. Es gibt Themen, die ich wichtig finde, und die ich trotzdem nicht – und schon gar nicht aus der besonders heiklen und missverstandenen Ich-Perspektive – behandeln würde. Anfangs war das natürlich anderes. Ich habe vor etwa 10 Jahren mit dem Schreiben im Internet begonnen und erst in den letzten zwei, drei Jahren ein verlässliches Gespür dafür entwickelt, wann etwas für mich zu privat ist. Meist stelle ich mir diese Frage, wenn ich unsicher bin: möchte ich, dass diesen Text jemand liest, den ich nicht mag? Ist es für mich trotzdem okay, wenn diese Person diesen Aspekt über mein Leben erfährt?
Für mich ist etwas dann zu privat, wenn ich das Gefühl habe, mich langfristig vor der breiten Masse bloßzustellen und ungefilterte Einblicke in mein Innerstes zu gewähren, die niemanden etwas angehen und die mich noch dazu beruflich nicht weiterbringen. Ich habe Hemmungen. Ich habe nicht keine Angst vor den Reaktionen. Ich weiß, dass da draußen nicht nur Menschen sind, die digital applaudieren, sondern auch welche, die verurteilen und sich ins Fäustchen lachen, wenn sie gewisse Dinge lesen. Ich will nicht verletzbarer sein, als es ohnehin schon nötig ist, um vom Schreiben zu leben. Denn so sehr ich es auch liebe: es gibt Aspekte, die gefährlich sind.
Eine Sache, die am Autorinnendasein schwierig ist: dass Menschen das Gefühl bekommen, in Autorinnen hineinsehen zu können. Dass sie denken könnten, ich bin meine Texte. Dabei sind meine (Ich)-Texte im Besten Fall eine eloquente Verdichtung des Erlebten, ein Relikt von etwas Verarbeitetem, eine Erinnerung an einen entfremdeten Aspekt meiner Vergangenheit – und nicht ich. Ich finde es schwierig, wenn Menschen denken, ich würde genauso ideal(istisch) handeln, wie meine Konklusionen vermuten lassen. Denn das tue ich nicht. Es gibt „die Autorin“ und dann gibt es mich. Mit ganz vielen Fehlern. Gerade bei Themen, nach deren Rezeption sich Leserinnen gut mit mir identifizieren können, bekomme ich Angst vor meiner eigenen Courage. Ja, ich habe vielleicht einen Nerv getroffen, ich habe vielleicht etwas so erzählen können, dass es auf möglichst viel Resonanz stößt – aber bitte, bitte verwechselt die erzählende Person oder die Protagonistin nicht mit mir. Verwechsle nicht die Wut im Text mit meiner eigenen Wut in diesem Moment.
Gedanken wie diese hemmen meinen Schreibfluss gelegentlich. Andere können da vielleicht komplett drüberstehen und mit ihrem Ego-Rasenmäher über alle rot aufblinkenden Warnschilder fahren. Ich kann es nicht. Die Gedanken stören mich beim Denken, beim Kunst-Produzieren – wenn man das so nennen will. Kunst, die nach außen getragen wird, und dort auf jemanden stößt, der sich in ihr widerfindet. Genau diese Motivation führt hin und wieder dazu, dass ich das Gefühl habe, zu viel preisgegeben zu haben.
Denn tbh: die Menschen lieben Too-Much-Information. Umso persönlicher, umso dramatischer, umso näher, desto besser. Desto mehr Klicks und Follower und Aufrufe und Traffic und Werbeeinnahmen. Es gibt ganze Bücher, die nur zustande gekommen sind, weil sich jemand mit seiner Leidensgeschichte exponieren wollte und die Verlage hingestarrt haben wie bei einem Autounfall. Auch ich muss gelegentlich aufpassen auf mich, um nach einem schönen Tag kein Liebesgeständnis mit passendem Knutschfoto zum Besten zu geben, weil ich gerührt bin und auch ein bisschen Cuteness-Punkte einheimsen will. Zum Beispiel.
Genauso wie mich meine Selbstreflektion heute davor bewahrt, einen Schnellschuss abzuliefern, hat mich die Sensationsgier schon dazu gebracht, über mein Ziel hinauszuschießen. Beispielsweise als ich einen Artikel darüber schrieb, wie egoistisch ich Menschen finde, die in Anwesenheit von Freunden tindern. Das Thema hätte ich an sich schon machen können, nur habe ich in diesem Fall zu viel meiner persönlichen Verletztheit preisgegeben, statt mich auf das „Problem“ als solches zu besinnen. Kurz: man hätte das Ganze auch etwas distanzierter und analytischer, statt persönlich-beleidigt aufschreiben können. Wie den „Arm und Asozial my Ass“-Text zum Beispiel, den ich wiederum bis heute in seiner Herangehensweise sehr gerne mochte. Für die Zukunft habe ich daraus gelernt, schmerzhafte persönliche Geschehnisse erst für mich zu verarbeiten und später zu entscheiden, ob und wie sie sich für einen Text eignen. Mit veränderten Namen, Orts- und Zeitangaben natürlich – ich möchte niemandes Persönlichkeitsrechte verletzen.
Social Media ist von der Thematik natürlich nicht ausgenommen.
Während ich dabei bin, mich mehr und mehr als Autorin, als Figur zu zeigen – und nicht als Privatperson – kommen ganz schön viele Fragen hoch. Ich sag nur: Nobody said it was easy. Auf Instagram ist mir zum Beispiel ein Foto dann zu privat, wenn ich das Gefühl habe, etwas preisgegeben zu haben, das ich schützen und aus nicht genau einordbaren Gründen für mich behalten möchte.
Dummes Beispiel: das Weihnachtsessen mit meiner Familie. Oder meine Liebesbeziehungen. Das Haus meiner Kindheit in der Slowakei. Meine Freunde ohne Internetpräsenz. Alte Fotos. Großeltern. Meine Wohnung, durch die ich bisher nicht digital geführt habe (kleine Fixpunkte wie den Spiegel im Wohnzimmer ausgenommen #aotd). Keine Morgenroutine. Keine Fotos im Bett. Keine Infos darüber, wann ich wie lange wo bin – und mit wem. Das kommt dann vielleicht später raus, aber ich bin schon immer bedacht und mir meistens im Klaren darüber, wie ich diese, meine Realität beschneide, um die eher anonymen beziehungsweise weniger privaten Momente auszuwählen, die ich dem Internet zugänglich mache, ohne mich nackt zu fühlen.
Bin ich paranoid? Vielleicht. Leben wir mit all unseren Bekannten und Verwandten und entfernten Frenemies in einem Big-Brother-Container namens Internet? Ganz sicher.
Hin und wieder über solche Grenzen nachzudenken, ist anstrengend, aber notwendig, um als Person irgendwo auf dem oberen Ende des Introvert-Spektrums diesem kräftezehrenden Beruf nachgehen zu können. Einem Beruf, der vom eigenen Image lebt, ja, der nur dadurch ausgeübt werden kann, sich in gewisser Weise zu exponieren. Jede Meinungsäußerung, jeder Post ist bereits eine Form der Exponierung. Man kann sich also als Autorin, die schreibt (haha!) gar nicht nicht exponieren. (Also aufpassen bei Kommentaren a la: „Du machst das doch alles freiwillig!!11“) Außer man möchte nur für sich schreiben, natürlich. Aber das möchte ich dann doch nicht.
Ich möchte so schreiben, dass es sich für mich okay anfühlt und Menschen trotzdem dort berühren, wo es weh- und guttut. Ich möchte reflektiert bleiben und mich nicht für einen reißerischen „Sex mit dem Ex“-Artikel hingeben, auch wenn ich in Punkto Beziehungen und Liebe bestimmt einige gute Anekdoten auf Lager hätte. Und in so manch anderen Themengebieten auch. Aber: das bin nicht ich. Die Autorin zu werden, die ich sein möchte, verlangt Disziplin und Selbstbeherrschung.
Meine angestrebte Professionalisierung verlangt nach Stille, auch wenn ich manchmal laut dazwischenschreien und meinen ungefilterten Senf abgeben möchte.
Sie verlangt danach, ganz gezielt an den Themen zu arbeiten, die in meinem Repertoire am stärksten sind und mich durch meinen Stil und meine Sichtweise von anderen abzuheben. Es verlangt Distanz zum Erlebten zu wahren und sich im Klaren darüber zu sein, dass man eben – in meinem Fall – nie die Person sein wird, die gerne vor der Kamera steht um dort über ihr Privatleben zu berichten. Ich werde nicht die Person sein, die ihre Hochzeit live auf Facebook streamt, oder ihre Kinder postet. Wenn ich schon über meine Gefühle schreibe, dann will ich zumindest das unmittelbare Privatleben so gut es geht raushalten. Auch wenn ich manchmal gerne wieder posten würde as if it was 2009.
Selbst wenn die Professionalisierung nerven kann – sie ist ein Schutzschild. Sie ist etwas Langfristiges. Und sie gibt mir den nötigen Rahmen, innerhalb dessen ich künstlerisch frei sein kann.
Also ein Tipp an alle Schreiberlinge da draußen: ran an die Entscheidung, über was man wie schreiben möchte.
Fragen, die dabei helfen können:
Ich freu mich auf eure Rückmeldungen und den Erfahrungsaustausch zu diesem heiklen Thema.
Diesen Beitrag gibt es hier auch als Audio.
Dir hat dieser Beitrag gefallen? Du hast ihn vielleicht sogar deinen Freunden empfohlen oder via Social Media geteilt? Dann unterstütze meinen Blog doch bitte durch eine kleine Spende. Dadurch kannst du sicherstellen, dass ich mich am Sonntag einmal pro Monat mit Sushi für die geistreiche, anstrengende und befriedigende Arbeit belohnen kann, die ich hier als Bloggerin neben meinem Hauptberuf kostenlos leiste und aller Welt zur Verfügung stelle. SEND MONEY TO GROSCHI (via PayPal)
1 Comments
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sehr interessant zu lesen und sehr hilfreich – vielen Dank! <3