Schreiben ist einer der intimsten Prozesse des menschlichen Daseins, den man mit niemandem teilen kann. Öffentlich gemacht wird alleine das Ergebnis nächtelanger Arbeit. Alle meine Texte für diesen Blog und die meisten Artikel für Auftraggeber sind entstanden, während ich alleine war. Nur ich und mein Computer. Und vielleicht eine Tasse Tee.

Wenn ich von Menschen umgeben bin, fehlt etwas. „Schreib doch mal“, sagt sich so leicht. Ich kann dann nicht ganz bei mir sein, wenn sie knäckebrotkauend auf mein sich langsam füllendes und wieder leerendes Word Dokument schielen. Nichts ist schlimmer, als beim Aufschreiben seiner Gedanken ertappt zu werden. Unfertige Textfragmente zu Gesicht zu bekommen. „Diesen Satz könntest du streichen!“ Sag mir sowas lieber per E-Mail. Während ich noch am arbeiten bin, verkneif es dir.
So bin ich auch heute alleine, während ich diesen Eintrag plane, neben mir steht eine Tasse Blutorangentee und ich versuche den Zustand in Worte zu fassen, den ich während des Schreibens erfahre. Ist es nicht gleichermaßen traurig und charakteristisch für das Schreiben an sich, dass man dabei eben alleine ist? Dass niemand da ist, der einem beistehen könnte, zustimmen oder zumindest zunicken? Alles muss man selbst machen. Auf seine innere Stimme vertrauen, die mir auch jetzt vorliest, während ich tippe. Sie klingt anders als ich. Es ist mein Text.
Manchmal bekomme ich das Gefühl, ich lebe gar nicht richtig, sondern existiere nur auf dem Papier, oder in diesem Worddokument. Bevor ich schreibe, da muss ich gelebt haben. So besteht das Leben eines Schreiberlings grob gesagt nur aus einer Abwechslung zwischen dem Draußen, dem Leben und dem Drinnen, dem sich-ans-Werk-machen, anfangen, an-den-Schreibtisch-setzen, und dem jämmerlichen Versuch, all das, was in der Zwischenzeit passiert ist mit dem adäquaten Vokabular auszustatten und in der richtigen Reihenfolge festzuhalten.
„Hast du heute was geschrieben?“
„Ein bißchen.“
„War es gut?“
„Das weiß ich immer erst achtzehn Tage später.“
Bukowski
Manchmal gelingt es besser. Ob ein Text gut ist oder nicht, weiß ich immer erst nach einiger Zeit, wenn ich nochmal drüber gehe. Natürlich, man hat so ein Gefühl, dass man hie und da einen Nerv getroffen haben könnte, aber ob die Gedanken bei den anderen wirklich so ankommen, wie sie das eigene Gehirn verlassen haben? Ich bezweifle, ohne das jetzt kommunikationswissenschaftlich anhand eines Modells erklären zu wollen. Jeder fertige Text ist am Ende nicht so, wie man ihn sich vorgestellt hat, während man „Schreiben, Gefühl, Prozess“ in seine Entwürfe tippte.
Schreiben, was soll das überhaupt sein. Wie kann ein Mensch so unfassbar viel Zeit mit einem Textverarbeitungsprogramm verbringen, freiwillig?
„Ich kann auch solange spazierengehen.“
„Nein, nicht allein, nicht in dieser Gegen hier.“
„Ich will dir beim Schreiben nicht im Weg sein.“
„Vom Schreiben kann mich nichts abhalten. Es ist eine Art von Besessenheit.“
Bukowski
Ich habe schon immer geschrieben und wenn ich zumindest etwas in meinem bescheidenen Leben vorhersagen kann, ist es, dass ich immer schreiben werde. Es gibt Phasen, da hat man das Gefühl nie wieder etwas Sinnhaftes zu Papier zu bringen. Jeder Einstieg, ein einziges Scheitern. Das sind bestenfalls die Phasen, in denen man sich oder seinen Schreibstil verändert. Fast wie in der Pubertät.
Es gab schon eine Zeit, da habe ich gar nicht mehr geschrieben, außer für die Universität. Als ich dann wieder aufs Bloggen zurückkam, habe ich Veränderungen in der Art meines Artikelaufbaus und der zugrundeliegenden Argumentation bemerkt, ohne dass ich konkret etwas dafür getan hätte. Außer Zeit verstreichen zu lassen.
Manche Menschen schreiben Tagebuch und meinen, das wäre für das Festhalten des eigenen Lebens geeigneter als ein Blog, oder Microbloggingdienst wie Twitter. Ich wiederum erkenne mich in jedem meiner Texte wieder, so unpersönlich sie auch wirken mögen. Ich tauche beim erneuten Lesen in die Zeit ein, in der ich die Zeilen geschrieben habe und manchmal, so wie gestern, erkenne ich meine Gegenwart in vergangenen Texten. Als ob ich sie vorausgesagt hätte. Wenn ich erneut sehe, wie ich über eine bestimmte Situation geschrieben habe. Und sei es nur mit diesem übertriebenen Augenzwinkern.
Dann erkenne ich, was ich schon damals dachte und heute umgesetzt habe. Es stimmt doch, dass die Gedanken von heute die Entscheidungen der Zukunft nicht unwesentlich beeinflussen. Das erschreckt mich, manchmal, wenn ich schreibe. Denn es ist immer wahr. Es ist immer das, was ich denke und fühle und manchmal stößt es mir auf, weil ich mich vor mir selbst und meinen unreflektierten Gedanken und nicht klar erkennbaren Wünschen fürchte.
Das Einzige, was ich sehe, ist, dass etwas da ist oder etwas verändert gehört und zu dem Zeitpunkt, als ich es erkenne, bin ich manchmal noch direkt im Schreib- und Veränderungsprozess. Schreiben als Therapie, hat doch irgendjemand mal gesagt. So weit würde ich jetzt nicht gehen, soll der Großteil meiner Texte doch nicht von mir selbst und meinen alltäglichen Gedanken handeln.
Dabei ist es lächerlich zu glauben, dass in meinen Blogeinträgen „nichts von mir“ stecken würde, auch wenn ich das Wort „Ich“ nicht explizit in den Mund nehme und nicht jede meiner zwischenmenschlichen Beziehungen im Internet ausschlachte. Jeder Satz, eine klammheimliche Offenbarung, die derjenige erkennt, an den sie gerichtet war. So ergeht es mir auch mit Texten von Freundinnen. Entscheidungen, die sie belasten oder neue Optionen, die sie noch nicht realisiert haben, spiegeln sich sofort in ihren Artikeln wieder.
Schreiben ist so viel mehr als das leise in-die-Tasten-hauen, während man im Dunkeln Nick Cave hört. Es ist ein Gefühl, es ist die akuteste Gegenwart und die vielleicht beste Reflexionsmöglichkeit, die fern von Therapie oder Freunden von den Menschen für den Menschen erfunden wurde.




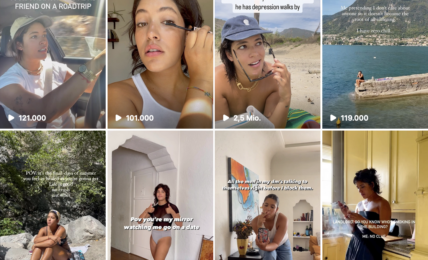
Sehr schön gesagt. Ich kann es auch nicht haben, wenn mir jemand „über die Schulter guckt“. Der Prozess ist viel intimer als das Ergebnis (und auch letzteres ist es noch).
Ich lese auch gerne mal Texte von mir ein Jahr später. Nicht, weil ich so narzisstisch bin, sondern weil ich gerne in den Kopf meines Vergangenheits-Ichs gucke. Da war irgendwie alles anders – und irgendwie doch alles gleich.